Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Fördergerüste im Ruhrgebiet | Schachtanlagen | Zeche | Bergwerk | Schachtanlage | Grube | Pütt | Fördergerüst | Schachtgerüst | Steinkohle | Ruhrpott | Zechen | Schacht | Ruhrrevier | Revier | Kohle | Förderturm | Aufbereitung | Grube | Bergbau
Wiesche | Ver. Wiesche - Diese Seite ist veraltert! Link -> Neue Seite
| <<< | zurück |
nächste
|
>>> |
| Status:
Herkunft des Namens: Nach geografische Lage "auf der Wiese" Grubenfeldgröße: unbekannt |
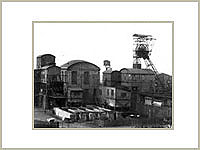 |
|
|
Schachtbezeichnung
|
E
|
F
|
Ø
|
T
|
|
| 1.) |
Wiesche I (Emilie I)
|
Nein
|
|
1,84x5,44
|
442m
|
1828-1961
|
| 2.) |
Friedrich
|
Nein
|
|
|
|
1809-
|
| 3.) |
Vereinigung
|
Nein
|
|
|
|
1842-1879
|
| 4.) |
Leybank
|
Nein
|
|
|
|
|
| 5.) |
Wiesche III (Velau)
|
Nein
|
|
|
|
1875-1924
|
| 6.) | Wiesche II (Emilie II) |
Nein
|
|
4,20m
|
442m
|
1896-1961
|
| 7.) | Wiesche IV (Frohnhauser Mulde) |
Nein
|
|
|
|
|
| 8.) | Wilhelmine |
Nein
|
|
|
|
1814-
|
| 9.) | WS Nordfeld |
Nein
|
|
1,75m
|
55m
|
|
![]()
Geschichtliche Entwicklung:
| vor 1700 | bereits Abbau |
| bis 1730 | zusammen mit Sellerbecker Stolln, Kinderberg und Leybank gemeinschaftlicher Förderstollen zur Ruhr = „Großer Stolln", dann aufgeschlossene Vorräte auch im Unterwerk abgebaut |
| 1779 | Zusammenarbeit mit Schökenbank und Kinderberg „zur Fündigmachung einesneuen Kohlbergs" |
| 1796 | Belehnung, außer Betrieb |
| 1809 | Wiederinbetriebnahme, Übergang auf Tiefbau: Teufbeginn Maschinenschacht Friedrich Karbon = 16 m |
| 1810 | Inbetriebnahme Wasserhaltungsdampfmaschine (von Franz Dinnendahl), deren Leistung aber unzureichend ist, Stollensohle = 19 1/2 Lachter, Tiefbausohle = 47 Lachter |
| 1811 | Maschinenschacht Friedrich 04.09.: Förderbeginn aus dem Flöz Dickebank mit Pferdegöpel, 1065 Lachter langer Schiebeweg zur tiefer gelegenen Stadt Mülheim |
| 1813 | Inbetriebnahme neue Wasserhaltungsdampfmaschine (von F. Dinnendahl), Ausbeute |
| 1814 | Teufbeginn Schacht Wilhelmine |
| 1816 | Inbetriebnahme Schacht Wilhelmine ab 1. S. = 65 Lachter = 136 m (Dampffördermaschine) |
| 1817 | Aufstellung neue Wasserhaltungsdampfmaschine (F. Dinnendahl) |
| 1819 | 23.08. Erste Kohlenförderung auf Schacht Wilhelmine |
| 1821 | Betrieb, Schächte Friedrich = Förderung und Wilhelmine = Wasserhaltung |
| 1825 | Betrieb |
| 1828 | Teufbeginn Schacht Emilie, Auffahren Ruhrstollen (s. Wiescher Erbstollen) größte Zeche im Ruhrrevier |
| 1829 | Schacht Emilie: Ansetzen 1. S. = 66 Lachter = 139 m(-31 m) |
| 1830 | Schacht Emilie Förderbeginn ab 2. S. = 81 Lachter =169 m(-61 m), bis 1840 eine der größten Zechen im Ruhrrevier |
| 1833 | Auftrag an Eisenhütte in Mülheim zum Bau einer stärkeren Wasserhaltungsdampfmaschine |
| 1836 | Schacht Friedrich: Inbetriebnahme der neuen Wasserhaltungsmaschine für 70 Lachter Teufe |
| 1837 | Lösung durch den Wiescher Erbstollen, Hebung der Wässer im Schacht Friedrich bis zur Erbstollensohle |
| vor 1840 | Einführung Pferdeförderung unter Tage |
| 1840 | Tieferteufen Schacht Emilie |
| 1841 | Schacht Emilie: Ansetzen 3. S. = 92 Lachter = 192 m(-54 m) |
| 1842 | Teufbeginn Schacht Vereinigung (für den geplanten Abbau im noch selbständigen Feld Leybank) bis 63 Lachtersohle = 132 m, Schacht Emilie: Anschluß an die Sellerbecker Bahn |
| 1843 | Schacht Emilie: Ansetzen 4. S. = 113 Lachter = 236 m(-128 m) |
| 1844 | 14.3. Verleihung Längenfeld Wiesche |
| 1846 | Abgabe Schacht Vereinigung an Verein |
| 1851 | Schacht Friedrich bis 2. S. = 163 m; Wettersohle = 50 m, Konsolidation zu Ver. Wiesche |
| 1851 | entstanden durch
Konsolidation von Wiesche mit Anna Gertrud, Holthauser
Bänksgen, Leybank, Richter, Schutzengel, Thiesgracht,
Valentin, Verein und vermutlich weiteren Berechtsamen;
Anlagen: Wiesche: Schacht Emilie, Förderschacht, bis 4. S. = 236 m(-128 m), Schacht Fried-rich, bis 2. S. = 163 m, Schacht Wilhelmine, bis 1. S. = 136 m, Verein: Schacht Vereinigung, Förderschacht, bis 63 Lachter-Sohle = 132 m, Leybank: Stollen mit Schächten, wahrscheinlich außer Betrieb |
| 1855 | Schacht Friedrich: Ansetzen 3. S. = 99 Lachter = 207 m und Durchschlag mit Schacht Emilie |
| 1856 | Tieferteufen Schacht Emilie |
| 1857 | Schacht Emilie: Ansetzen 5. S. = 145 Lachter = 303 m(-195 m, später als 282 mS neu angesetzt) |
| 1859 | Schacht Vereinigung: Fördereinstellung, Baufeld zu Schacht Emilie |
| 1860 | Schacht Vereinigung wird Wetterschacht, 1.6. Standwassereinbruch (3 T) |
| 1861 | im Unterwerk Ansetzen 6. S. = 320 m(-212 m) und Zwischensohle = 332 m (-224 m), Inbetriebnahme Brikettfabrik (erste im Ruhrrevier), Übernahme Jean Paul, bergbehördliche Bestätigung der Konsolidation von 1851 |
| 1863 | Einrichtung Seilfahrt in Schacht Emilie |
| 1864 | Tieferteufen Schacht Emilie bis 6. S. |
| 1865 | Beginn Ablösung des Zehnten bei der Mülheimer Zehntgesellschaft (bis 1871) |
| 1866 | Verleihung Geviertfeld Richter |
| 1867 | Stilllegung Brikettfabrik wegen hoher Pechkosten und unzureichender Erlöse |
| 1870 | 4 Schächte in Betrieb: Emilie, Friedrich, Vereinigung und Leybank |
| 1875 | Teufbeginn Wetterschacht Velau = 3 (im Nordfeld, an Reuterstraße): Karbon bei 45 m (Teufe: 55 m) |
| 1876 | Schacht Emilie: Ansetzen 7. S. = 382 m(-274 m), Verleihung Geviertfelder Wiesche IV und V |
| 1878 | Schacht Emilie: Ansetzen 8. S. = 432 m(-324 m) und Ersatz Holzfördergerüst durch gemauerten Förderturm |
| 1879 | Stilllegung Schacht Vereinigung und Aufgabe |
| 1880 | Stilllegung Schächte Friedrich und Leybank (später Aufgabe und Verfüllung) |
| 1887 | Inbetriebnahme neue Brikettfabrik |
| 1888 | 13.8. Wassereinbruch und Absaufen 8. S. |
| 1890 | Sümpfen und Aufwältigung der 8. S. |
| 1895 | Teufen tonnlägiger Wetterschacht 4 in Frohnhauser Mulde: 44 m Teufe und anschließend 600 m Abhauen, 14.5. Schlagwetterexplosion (3 T) |
| 1896 | Teufbeginn Sch. 2 (100 m neben Schacht Emilie = 1): Karbon bei 16 m, 1.7. Stilllegung Brikettfabrik |
| 1897 | Sch. 2 bis 8. S., Verleihung Geviertfeld Fuchs I, Berechtsame: 5 Geviert- und 4 Längenfelder = 5,5 km² |
| 1898 | Besitzerwechsel und Umbenennung in Wiesche aus Ver. Wiesche, Eigentümer: Mülheimer Bergwerksverein; Berechtsame: 5,5 km², 4 Schächte: 1 = Emilie/2 (beide bis 8. S. = 432 m(-324 m)), Wettersch. 3 = Velau, Wettersch. 4 = Frohnhauser Mulde, Sch. 1: Fördereinstellung, Sch. 2: Förderbeginn ab 8. S., Brikettfabrik außer Betrieb |
| 1899 | Reparatur Sch. 1, Inbetriebnahme neue Kaue |
| 1900 | Durchschlag mit Rosenblumendelle, Abbau unterhalb 8. S. mittels Gesenk, 1.4. Wiederinbetriebnahme Brikettfabrik |
| 1901 | Wassereinbruch im Südfeld, Wetterschacht im Nordfeld in Betrieb, Feld Anna Gertraud gehört zum Grubenfeld |
| 1902 | 1.4. Stilllegung Brikettfabrik, Sch. 1 = Emilie erhält eisernes Fördergerüst |
| 1903 | Sch. 1 wieder in Förderung |
| 1904 | Ansetzen 9. S. = 552 m(-444 m) im Gesenk, 1.1. Wiederinbetriebnahme Brikettfabrik |
| 1905 | Tieferteufen Sch. 2 |
| 1906 | Abgabe Feldesteil an Humboldt, Durchschlag mit Humboldt, Sch. 2 bis 9. S. |
| 1909 | Übernahme Felder Sellerbeck, Anna 1 sowie südlichen Teil von Ludwig 1 von Roland (Wetterschacht Christian bis 2. S. Carnall = 251 m, Berechtsame: 8,3 km²), gesamt: 13,8 km² |
| 1910 | Aufschluß Feld Sellerbeck |
| 1913 | Absturz Förderkorb (4 T) |
| 1914 | Aufbrechen Sch. 1 ab 9. S. |
| 1915 | Sch. 1 bis 9. S. in Betrieb |
| 1918 | 16.6. Standwassereinbruch auf 6. S. von Sellerbeck, nach 2 1/2 Monaten 9. S. gesümpft |
| 1924 | Sch. 1 wird Wetterschacht, Aufgabe Wetterschächte 3 und 4 |
| 1929 | Durchschlag mit Rosenblumendelle (Feld Humboldt) |
| 1930 | Übernahme Förderung aus dem Feld Humboldt |
| 1931 | 31.3. Übernahme Feld Humboldt mit Schacht Franz (bis 5. S. = 521 m) von Rosenblumendelle, Beginn Aufschluß des Feldes |
| 1937 | 25.6. Feld Humboldt: giftige Gase (3 T) |
| 1938 | Sch. 2: Ansetzen 10. S. = 750 m(-642 m) |
| 1946 | Anlagen: Wiesche 1/2, Humboldt, Wetterschacht Christian (Feld Sellerbeck); Hauptfördersohle: 10. S. |
| 1949 | Abbaueinstellung im Feld Sellerbeck und Abwerfen sowie Verfüllen Wetterschacht Christian |
| 1951 | Durchschlag mit Rosenblumendelle |
| 1952 | 1.1. Verbund zu Rosenblumendelle/Wiesche |
![]()
